DARF MAN PUTIN RESPEKTIEREN?
Was, wenn die Meinungsfreiheit anderen im Wege steht?
Er ist eine Legende der Formel 1, mehrfacher Milliardär und 91 Jahre alt. Zahlreiche Persönlichkeiten aus dem Sport, der Politik und der Wirtschaft suchte die Nähe von Bernie Ecclestone. Er ist eine wahrlich eine schillernde, streitbare und zu weil widersprüchliche Persönlichkeit. Für kaum einen der geltungsbedürftigen Eliten war das jedoch Grund genug, ihn zu meiden, öffentlich zu verurteilen oder zurechtzuweisen.
Glaubt man den unterschiedlichen Gerüchten, wird Bernie Ecclestone immer wieder mal mit kleineren Verfehlung, fragwürdigen Handlungen und verbalen Entgleisungen in Verbindung gebracht. Aber was soll´s, es ist Herr Ecclestone – man sieht ihm sicher vieles nach, schaut nicht so genau hin und wiegelt vieles als arrogante, altersbedingte Spinnerei ab – bisher!
Nun ist der einstige Star des professionellen Motorrennsports plötzlich, aber durchaus nicht unerwartet, in tiefe Ungnade gefallen. Ein Strafverfahren wegen Betruges wurde eröffnet. Das Verfahren bezieht sich angeblich auf bisher unbekannte Vermögenswerte in Höhe von rund 400 Millionen. Diese Vorwürfe dürften den englischen Strafverfolgungsbehörden jedoch vermutlich seit längerem bekannt sein, Herr Ecclestone ist schließlich 91 Jahre alt und hat die strittigen Vermögenswerte offensichtlich nicht erst gestern erwirtschaftet. Da stellt sich die Frage, warum jetzt? Was brachte das Fass zum überlaufen? Wem ist Herr Ecclestone aktuell auf den Fuß getreten?
Ecclestone bezeichnet den russischen Präsidenten Putin als Freund und hat sich im Februar 2022, kurz nach Beginn der russischen Militäroperation gegen die Ukraine, öffentlich und keinesfalls ablehnend dazu geäußert. Er erklärte sinngemäß, dass „Putin mit der Invasion in die Ukraine lediglich etwas getan habe, von dem er dachte, dass es das Richtige für Russland wäre". Später legte er noch einmal nach und erklärte, Putin sei „eine erstklassige Persönlichkeit“.
Wumm – das geht in der westlichen Wertegemeinschaft, in dem die Meinungsfreiheit ein hohes Gut ist, natürlich auf keinen Fall. Es hagelte Kritik von allen Seiten, die Formel 1 und ein Teil der politischen Eliten in England und in Europa distanzierten sich umgehend.
Dann trat Ruhe ein. Die Medien in England gingen offensichtlich davon aus, dass die „unglaubliche Entgleisung“ der einstigen Formel 1 Größe in die unergründlichen Tiefen der Archive versickert ist. Aber wie zu vermuten war, vergisst Justitia, egal in welchem europäischen Land, natürlich nichts.
Am 22.08.22 platzte dann die juristische und damit auch mediale Bombe. Der Print- und TV-Journalismus überschlug sich mit der Sensationsmeldung, dass gegen Herrn Ecclestone ein Verfahren wegen Betruges auf den Weg gebracht wurde. Wie zu erwarten war, ist dann auch der Zeitpunkt der Verfahrenseröffnung rein zufällig gewählt und auf keinen Fall politisch motiviert.
Die juristische und organisatorische Vorbereitung eines Strafverfahrens nimmt, je nach Schwere des Falles, zwischen zwei bis neun Monate in Anspruch. Die Putin-freundlichen Aussagen Ecclestones erfolgten Mitte Februar. Ein Schelm und Scharlatan also, wer hier, nach fast genau sechs Monaten, einen expliziten, politischen Zusammenhang herstellt.
In Europa darf jeder Bürger frei, offen und ungezwungen seine Meinung äußern, ohne dass dafür Konsequenzen zu befürchten sind. So auch im Vereinigten Königreich, oder bin ich hier auf dem Holzweg?
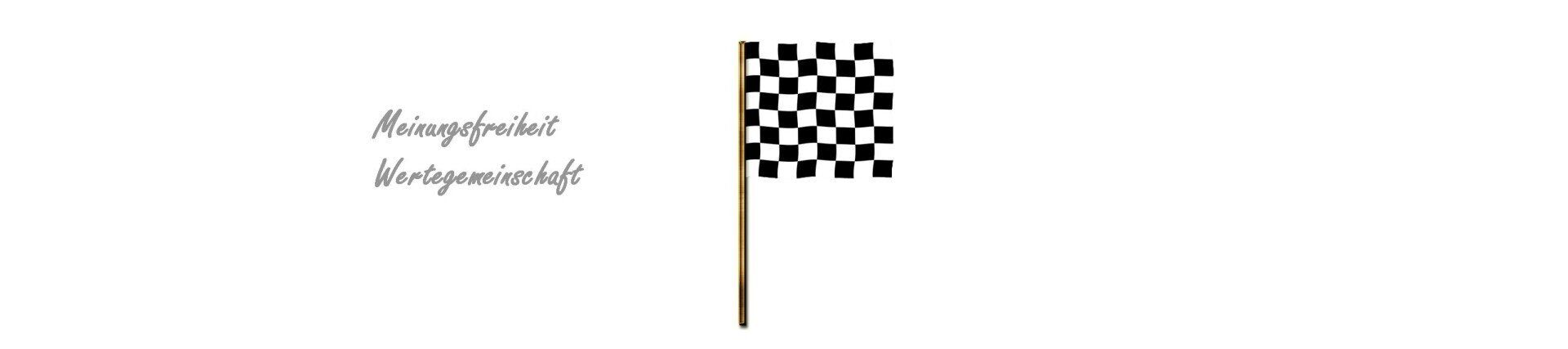
journaclean




